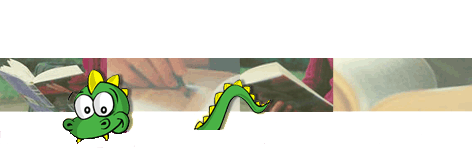„Der nubische Prinz“ von Juan Bonilla
Mein Job war es, Leben zu retten. So einfach war das. Sie werden denken, ich übertreibe, oder dass ich mich wichtig machen möchte: das ist Ihr gutes Recht, doch tatsächlich bezahlte man mich dafür, Leben zu retten, und je mehr Leben ich rettete, desto reicher wurde ich. Damals war mein Leben wie eine Tennispartie: einer der Spieler blieb immer zu Hause, in dem Wohnzimmer mit dem riesigen Fernseher, in der Dunkelkammer, wo die Tage beim Entwickeln von Fotos nur so verflogen, in dem Viertel also, in dem ich alles hatte, was ich zum Glücklichsein brauchte – die Bar, in der ich gemütlich und in aller Ruhe frühstückte, eine kleine Buchhandlung, in der ich mich mit interessanten Büchern eindecken konnte, ein Obstladen unter der Fuchtel einer Matrone mit Strahlebacken, die mir immer die besten Weintrauben und die saftigsten Pfirsiche zurücklegte, ein Friseursalon, wo ich mich ein paar Mal pro Woche rasieren ließ, und sogar ein Cybercafé, in dem ich stundenlang im Internet surfte. Der andere Spieler bewegte sich über den halben Kontinent, in dem Revier, das man mir zugeteilt hatte. Er reiste an die Küsten von Cádiz und bis nach Sizilien. Normalerweise bestimmte ich selbst, wo dieser Spieler sich befand, doch manchmal entschieden die Umstände für mich: wenn eine große Schiffsladung Albaner in Brindisi ankam, musste ich schnell nach Rom fliegen und dort ein Auto mieten, um in die Stadt zu gelangen, in der mich der zweite Spieler meiner Tennispartie erwartete.
Worin bestand dein Job?, werden Sie jetzt vielleicht fragen. Was sollen wir uns darunter vorstellen, Leben zu retten? Nun gut, ich rettete keine Leben in dem Sinne, wie es Feuerwehrleute oder Rettungsschwimmer tun: sie retten eigentlich nichts weiter als Körper. Ich jedenfalls habe noch keinen Feuerwehrmann erlebt, der einem Bürger, nachdem er ihn aus den Flammen befreit hat, ein neues, besseres Leben versprochen hätte, eine Rettung, die über die Feuerleiter hinausginge, über die er ihn bis zur Straße und zum Erste-Hilfe-Wagen geschleppt hat. Ich kenne keinen Rettungsschwimmer, der dem halb ertrunkenen Badenden nach der Mund-zu-Mund-Beatmung vorgeschlagen hätte: heirate mich. Mein Job bestand darin, nach Schönheit zu suchen, die Hände in den Schlamm zu stecken und Schmuckstücke herauszuziehen, die ich reinigte, anständig herrichtete und vorbereitete, damit sie den Preis einstreichen konnten, den sie verdienten. Ich reiste dorthin, wo das Elend solche Kleinodien versteckt hielt. Mit unerschöpflicher Geduld stöberte ich sie auf und barg sie. Das nenne ich Leben retten.
© Rogner & Bernhard 2004